Sachverhalt des BAG-Falls zum Tod nach Zahn-OP
Ein 18-jähriger Patient starb 2016 nach einer achtstündigen Zahnbehandlung unter Vollnarkose. Der Anästhesist setzte die Narkose unter klaren Verstößen gegen Leitlinien ohne ausreichende Ausstattung und ohne Assistenz ein und klärte den Patienten darüber nicht auf. Als sich der Zustand des Patienten verschlechterte, wurde zu spät der Notruf gerufen; er verstarb noch am selben Abend.
Das LG Hamburg verurteilte den Anästhesisten wegen Körperverletzung mit Todesfolge (§§ 223, 224 I Nr. 5 StGB) zu 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung, die Zahnärztin wurde freigesprochen. Der BGH hob nun beide Urteile teilweise auf:
- Anästhesist: Das Urteil bleibt im Schuldspruch bestehen, aber die Strafzumessung muss neu verhandelt werden. Das LG hatte mögliche Strafmilderungen (Verbotsirrtum, Verfahrensverzögerung) nicht hinreichend geprüft.
- Zahnärztin: Ihr Freispruch wurde aufgehoben, weil das LG nicht ausreichend untersucht hatte, ob sie angesichts der extrem langen und unsicher geplanten Behandlung ihre Informations- und Kontrollpflichten verletzt hat.
Ergebnis: Gegen beide Angeklagten werden die Verfahren wieder aufgerollt – beim Anästhesisten nur zur Strafhöhe, bei der Zahnärztin zur Schuldfrage.
Ärztliche Eingriffe als Körperverletzung
Strafrechtlich gilt: Jeder ärztliche Eingriff erfüllt zunächst den Tatbestand der Körperverletzung (§ 223 StGB). Er ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Patient wirksam einwilligt.
Eine solche Einwilligung setzt voraus, dass der Patient umfassend aufgeklärt wurde – nicht nur über allgemeine Risiken, sondern auch über Abweichungen von medizinischen Standards. Genau daran fehlte es hier: Der Anästhesist verschwieg, dass er ohne Assistenz und ohne ausreichende Geräte arbeiten würde.
Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB)
Der Patient starb infolge der Narkose. Das Landgericht sah darin die Verwirklichung einer typischen Gefahr der Vollnarkose – ein Lungenödem – und stellte den erforderlichen Zusammenhang zwischen Körperverletzung und Todesfolge her. Damit war der Tatbestand des § 227 StGB erfüllt. Der BGH stellte dies nicht infrage.
Der Verbotsirrtum (§ 17 StGB)
Besonders interessant ist die Schuldfrage: Der Anästhesist wusste zwar, dass er nicht nach Leitlinien handelte, glaubte aber, dies mit seiner Erfahrung kompensieren zu können.
Hier stellt sich die Frage nach einem Verbotsirrtum im Sinne des § 17 StGB: Irrte der Anästhesist über die rechtliche Bewertung seines Handelns? Das Landgericht deutete das an, prüfte aber nicht, ob eine Strafmilderung daraus folgt. Der BGH sah hierin einen Rechtsfehler – die Strafzumessung für den Anästhesisten muss deshalb neu verhandelt werden.
Patientenautonomie und Aufklärungspflichten
Der Fall verdeutlicht, wie weitreichend die ärztliche Aufklärungspflicht ist. Patienten müssen nicht nur wissen, welche Risiken „normalerweise“ bestehen, sondern auch informiert werden, wenn der Arzt bewusst von Standards abweicht. Nur dann können sie eine wirklich informierte Entscheidung treffen. Fehlt diese Aufklärung, ist eine Einwilligung unwirksam.
Verantwortung der Zahnärztin
Rechtlich interessant ist auch die Rolle der Zahnärztin. Das Landgericht hatte sie freigesprochen, weil sie auf den Facharzt für Anästhesie vertrauen durfte. Der BGH hob das auf: Bei einer außergewöhnlich langen Behandlung und einer unsicheren Planungsgrundlage hätte die Zahnärztin eigene Pflichten gehabt – etwa, den Anästhesisten rechtzeitig über den Verlauf zu informieren und kritisch zu hinterfragen, ob die Bedingungen noch vertretbar waren.
Damit rückt die Frage nach der Verantwortung bei Arbeitsteilung im Ärzteteam in den Fokus.
Verfahrensrechtliche Aspekte: Überlange Verfahren
Der BGH wies außerdem darauf hin, dass mögliche rechtswidrige Verfahrensverzögerungen berücksichtigt werden müssen. Eine Kompensation (z. B. durch Strafmilderung) kann den Angeklagten zustehen, wenn Verfahren zu lange dauern.
Bedeutung des BGH-Falls zum Tod nach Zahn-OP für die Praxis
Der Fall zeigt gleich mehrere neuralgische Punkte auf:
- Strafrechtlich: Reichweite der Aufklärungspflichten, Zurechnung der fahrlässig verursachten Todesfolge beim § 227 StGB, Relevanz eines Verbotsirrtums nach § 17 StGB für eine etwaige Strafmilderung
- Medizinrechtlich: Wie weit dürfen Ärzte aufeinander vertrauen, und wann greift eine eigene Kontrollpflicht
- Prozessual: Einfluss einer überlangen Verfahrensdauer auf das Strafmaß
Für die ärztliche Praxis bedeutet das Urteil, dass blindes Vertrauen auf Kollegen gefährlich sein kann. Bei außergewöhnlichen Eingriffen sind Kommunikation und Kontrolle Pflicht. Für die Strafjustiz unterstreicht der BGH, dass auch scheinbare „Randthemen“ wie der Verbotsirrtum oder Verfahrensverzögerungen sorgfältig geprüft werden müssen.
Die Entscheidung des BGH betont, dass bei ärztlichen Eingriffen ohne ordnungsgemäße Aufklärung keine wirksame Einwilligung vorliegt und sich daraus strafrechtliche Verantwortung bis hin zur Körperverletzung mit Todesfolge im Sinne des § 227 StGB ergeben kann. Zugleich verdeutlicht sie, dass bei außergewöhnlichen Behandlungen erhöhte Kontroll- und Organisationspflichten auch im Verhältnis zwischen behandelndem Zahnarzt und Anästhesist bestehen.
Kompetente Beratung durch erfahrene Strafverteidiger
Wie oben gezeigt, können bereits kleine Details einen erheblichen Unterschied bezüglich der Höhe einer etwaigen Strafe machen. Die richtige Beurteilung solcher Feinheiten ist komplex, von entscheidender Bedeutung ist daher eine kompetente rechtliche Beratung.
Als erfahrene Strafverteidiger können wir Ihnen helfen, Ihre rechtliche Situation besser zu verstehen und die beste Strategie zu entwickeln. Wenn Sie Fragen zu Ihrem individuellen Fall oder zu anderen strafrechtlichen Themen haben, kontaktieren Sie uns gerne.








.svg)

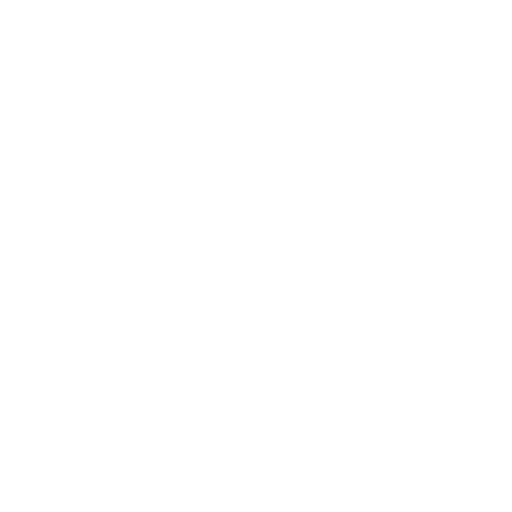
.svg)





.svg)
.svg)

.svg)



.svg)
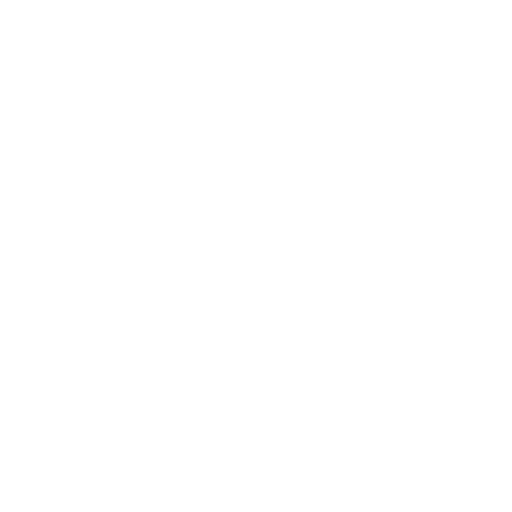



.png)



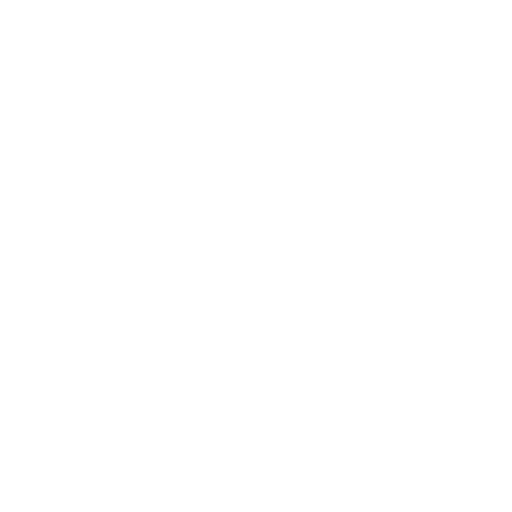
.png)
.png)








